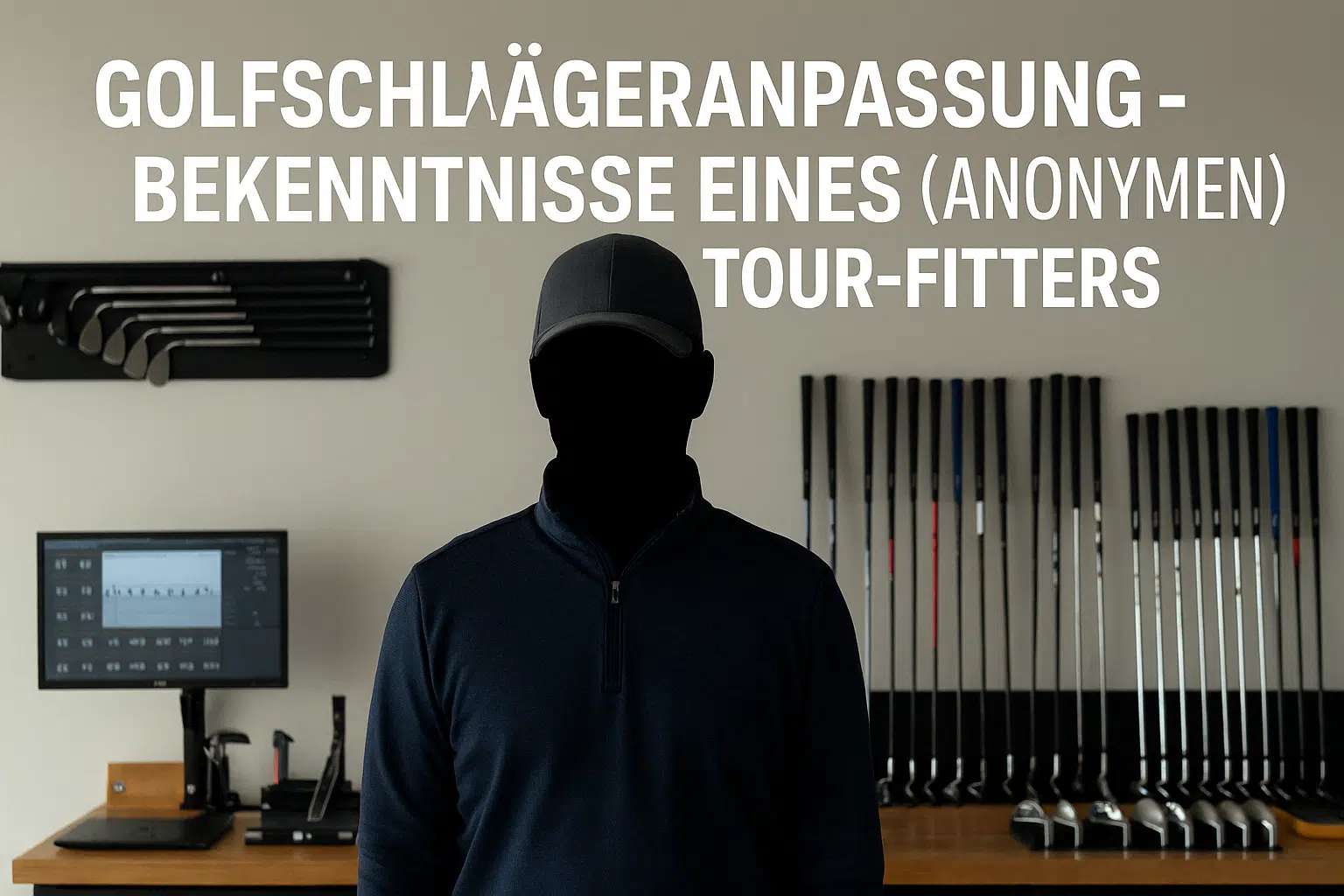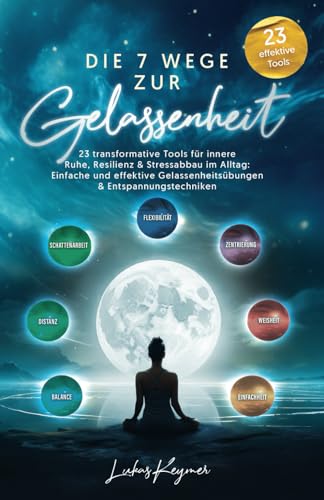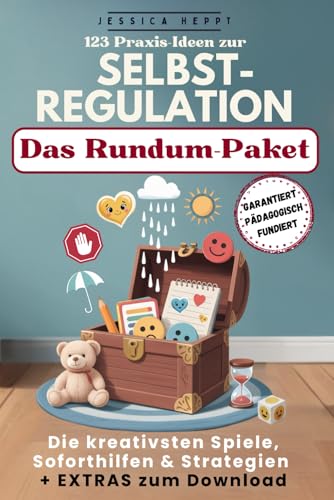Einleitung und Problemstellung
In vielen deutschen Golfclubs klafft eine wachsende Diskrepanz zwischen der Bedeutung und Verantwortung der PGA-Professionals und deren tatsächlicher Vergütung sowie Einfluss. Während Golflehrer (Club-Pros) oft das tägliche operative Geschäft maßgeblich stemmen – vom Training über Turnierorganisation bis zur Mitgliederbetreuung – spiegelt sich dieser hohe Stellenwert nicht in angemessener Bezahlung oder Mitspracherecht wider. Die Struktur deutscher Clubs trägt dazu bei: Häufig fungiert ein ehrenamtlicher Präsident als nomineller Clubmanager, wodurch der/die Golfprofessional de facto die operative Leitung vor Ort übernimmt. Diese Konstellation birgt Konflikte und Herausforderungen in Bezug auf Entlohnung, Anerkennung und Entscheidungsbefugnisse.
Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass dieser Graben größer wird. Vergütungen stagnieren häufig oder halten kaum mit steigenden Lebenshaltungskosten Schritt, trotz wachsender Anforderungen an die Professionals (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). Anerkennung und Einfluss bleiben begrenzt – viele Pros haben keine formale Managementposition und sind in strategischen Entscheidungen oft außen vor. Gleichzeitig warnen Branchentrends: In den USA etwa hat sich in den letzten Jahrzehnten ein deutliches Gefälle zwischen hochbezahlten Club-Managern und vergleichsweise geringer entlohnten Head-Pros entwickelt (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). Diese Entwicklung – übertragen auf deutsche Verhältnisse mit ihren eigenen strukturellen Besonderheiten – macht ein Umsteuern notwendig.
Im Folgenden werden die aktuelle Situation analysiert und darauf aufbauend konkrete Strategien und Maßnahmen vorgeschlagen, um Vergütungsmodelle zu verbessern, die Anerkennung und den Einfluss von PGA-Professionals zu steigern sowie die Cluborganisation und Kommunikation zukunftsfähig zu gestalten. Ziel ist es, praktische Handlungsempfehlungen für deutsche Golfclubs zu formulieren, um die wertvolle Rolle der Golfprofessionals angemessen zu honorieren und effektiv einzubinden.
Analyse der aktuellen Situation
Vergütungssituation der PGA-Professionals in Deutschland
Die Gehälter von Golfprofessionals in Deutschland liegen im Durchschnitt deutlich unter denen vergleichbarer Fachkräfte anderer Branchen. Laut aktuellen Jobmarkt-Daten verdient eine Golflehrerin im Schnitt nur rund 36.900 € brutto pro Jahr (Medianwert) (Golflehrer/in Gehälter in Deutschland 2025 – StepStone ). Typischerweise bewegt sich das Grundgehalt in einer Spanne von etwa 30.000 € bis 45.000 € jährlich (Golflehrer/in Gehälter in Deutschland 2025 – StepStone ). Erfahrene Head-Professionals oder Golfmanager an großen Anlagen können darüber hinauskommen – Schätzungen nennen für „Head Golf Professionals“ teils Werte über 50.000 € (Gehalt: Golf Professional in Deutschland 2025 – Glassdoor). Dennoch bleibt festzuhalten, dass viele Club-Pros mit einem Jahreseinkommen im mittleren fünfstelligen Bereich auskommen müssen, was im Verhältnis zu ihren Aufgaben als moderat bis niedrig einzustufen ist.
Zum Vergleich: Andere Angestellte in deutschen Golfanlagen erzielen im Schnitt höhere Einkommen. Einer Studie zufolge lag das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Golfclubs bei ca. 44.600 €, was nur etwa 76,9 % des bundesdeutschen Durchschnittsgehalts entspricht (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Human Resource Management im Golfsport). Dies verdeutlicht, dass Golfclubs tendenziell unter Marktniveau bezahlen, auch begünstigt durch spezielle Faktoren wie eine hohe Anzahl von Teilzeitkräften und die Leidenschaft der Mitarbeiter für den Sport (viele nehmen aus Idealismus geringere Löhne in Kauf) (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Human Resource Management im Golfsport). Zwar gab es in den letzten Jahren in der Branche leichte Gehaltsanstiege – eine Umfrage des Golf Management Verbandes Deutschland (GMVD) zeigt z.B. einen Anstieg des Durchschnittsgehalts auf ca. 66.000 € im Managementbereich bis 2021 (So viel verdienen Fach- und Führungskräfte in der Golfbranche) – jedoch betrifft dies vor allem Clubmanager und Führungskräfte. Teaching-Professionals und Trainer sind von solchen Steigerungen oft ausgenommen und rangieren eher in den niedrigeren Gehaltsbändern (30.000–50.000 €) (So viel verdienen Fach- und Führungskräfte in der Golfbranche).
Zudem basiert die Vergütung von Golfpros in Deutschland häufig auf individuellen Vereinbarungen, da es keinen Tarifvertrag in diesem Bereich gibt (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Human Resource Management im Golfsport). Viele Professionals sind nicht fest angestellt, sondern arbeiten auf eigene Rechnung oder im Rahmen einer selbstständigen Golfakademie. Tatsächlich geben nur 12 % der deutschen Golfclub-Manager an, dass die Pros weisungsgebundene Angestellte des Clubs sind (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Human Resource Management im Golfsport). In der Praxis bedeutet das: Ein Großteil der Pros erzielt sein Einkommen über Honorarstunden (Trainerstunden), Provisionsmodelle oder Pachteinnahmen (z.B. aus dem Pro-Shop) statt über feste Gehälter. Fällt z.B. der Pro-Shop-Umsatz geringer aus oder ist die Unterrichtsnachfrage saisonbedingt schwach, spiegelt sich das direkt im Verdienst der Trainer wider. Zusatzleistungen wie Beteiligungen an Mitgliedsbeiträgen, Greenfee-Einnahmen oder Cart-Gebühren, die früher teils üblich waren, sind heute selten. (In den USA etwa haben viele Pros ihre früheren Einnahmequellen aus Shop-Verkäufen und Cart-Verleih an den Club verloren (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap) – Ähnliches wird in Deutschland teils beobachtet, wenn Clubs Pro-Shops in Eigenregie führen und so die Verdienstmöglichkeiten der Pros beschneiden.) Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gehaltsentwicklung der PGA-Professionals nicht mit ihrem gestiegenen Verantwortungsumfang Schritt gehalten hat – eine Schere, die es zu schließen gilt.
Aufgabenprofil und Verantwortung von Golfprofessionals
Die Rolle des PGA-Golfprofessionals in deutschen Clubs geht weit über das Geben von Unterricht hinaus. Gerade in Clubs ohne hauptamtlichen Manager übernehmen Pros eine zentrale Funktion im Tagesgeschäft. Zu ihren typischen Aufgaben und Verantwortungsbereichen zählen unter anderem:
- Golfunterricht und Training: Erteilen von Einzel- und Gruppenstunden, Ausbildung von Anfängern, Jugendtraining und Förderung des Mannschaftssports (Club-Teams). Der Pro ist erster Ansprechpartner für die spielerische Entwicklung der Mitglieder.
- Sport- und Turnierbetrieb: Planung, Organisation und Durchführung von Turnieren und Wettspielen, inkl. Turnierkalender, Startzeiten, Auswertung und Handicap-Verwaltung. Oft obliegt dem Professional auch die Rolle des Turnierdirektors und Regel-Experten im Club.
- Pro-Shop und Merchandising: Viele Pros managen den Pro-Shop (Verkauf von Schlägern, Bällen, Kleidung etc.), inklusive Wareneinkauf, Lagerhaltung und Beratung der Kunden. Ist der Shop verpachtet, fungiert der Pro dennoch häufig als Material- und Fitting-Experte für die Mitglieder.
- Mitgliederbetreuung und Akquise: Als „Gesicht des Clubs“ pflegt der Golfprofessional den direkten Kontakt zu Mitgliedern und Gästen, steht für Fragen rund ums Golfspiel zur Verfügung und trägt wesentlich zur Bindung von Mitgliedern bei. Bei Schnupperkursen oder Platzreife-Kursen wirkt er an der Gewinnung neuer Mitglieder mit.
- Operatives Management vor Ort: In Abwesenheit eines hauptamtlichen Managers sorgt der Pro dafür, dass der Laden läuft – Abstimmung mit Greenkeeping bezüglich Platzbespielbarkeit, Koordination mit dem Sekretariat, ggf. Dienstplanerstellung für Trainerassistenten, und spontanes Lösen täglicher Probleme. Er ist faktisch der Kümmerer für alle Belange auf der Anlage.
Diese Vielseitigkeit führt dazu, dass der Golfprofessional oft unzählige „Hüte“ trägt. Ein Branchenbeobachter in den USA beschreibt es treffend: „Pro-Shop-Manager, Turnierdirektor, Merchandiser, Trainer, Starter, Seelsorger und sogar Zeremonienmeister – der PGA-Pro macht alles, ohne die Entlohnung, die der Arbeitslast entspricht“ (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). Dieses Zitat mag aus dem amerikanischen Kontext stammen, trifft aber im Kern auch auf Deutschland zu. Viele deutsche PGA-Pros fühlen sich ähnlich als Allzweckkräfte, deren tatsächlicher Verantwortungsbereich weit über das offiziell Vorgesehene hinausgeht – häufig ohne entsprechende Anpassung von Status oder Gehalt. Insbesondere in kleineren Clubs hängt der gesamte Golfbetrieb an der Expertise und dem Engagement des Professionals.
Das nachfolgende Schema veranschaulicht die Diskrepanz zwischen Aufgabenfülle und Vergütungsmodell exemplarisch:
| Rolle/Aufgabe des Golfpros | Verantwortung | Übliche Vergütung/Status |
|---|---|---|
| Golfunterricht & Training | Einzel- und Gruppenunterricht, Platzreifekurse, Jugendtraining | Stundenhonorare (selbstständig oder Umsatzbeteiligung mit Club) |
| Turnierorganisation & Sportbetrieb | Planung und Durchführung von Turnieren, Handicapverwaltung, Regelberatung | Oft erwartet als Teil der Tätigkeit, ohne separate Bezahlung (im Pauschalvertrag abgedeckt) |
| Pro-Shop Management | Einkauf/Verkauf von Golfartikeln, Schlägerfitting, Lagerhaltung | Variiert: teils eigenständige Shop-Pacht (Gewinn für Pro); andernorts Shop in Clubregie → kein oder geringer Zuschlag für Pro |
| Mitgliederbetreuung & Akquise | Betreuung der Mitglieder und Gäste, Gewinnung neuer Golfer (Schnupperkurse) | Keine direkte Vergütung – Leistung wird indirekt erwartet, Anerkennung oft immateriell |
| Operatives Clubmanagement (informell) | Koordination des Tagesgeschäfts, Absprachen mit Greenkeeping, Präsenz als „Manager vor Ort“ bei Abwesenheit des Vorstands | In vielen Clubs inoffiziell vom Pro übernommen; kein offizieller Manager-Titel, Vergütung allenfalls durch pauschales Honorar abgegolten |
Tabelle: Hauptaufgaben eines Club-Professionals vs. übliche Vergütungsmodelle in deutschen Golfclubs.
Wie ersichtlich, besteht besonders in den Bereichen außerhalb des reinen Golfunterrichts oft eine Lücke zwischen Verantwortung und formaler Honorierung. Viele dieser Tätigkeiten werden als „selbstverständlich“ angesehen, weil der Pro eben vor Ort ist. Daraus resultiert mitunter Frustration bei den Professionals: Sie tragen wesentlich zum Club-Erfolg bei (Zufriedenheit der Mitglieder, reibungsloser Spielbetrieb, Umsatz im Shop etc.), fühlen sich aber finanziell und hierarchisch nicht entsprechend gestellt.
Strukturelle Besonderheiten: Ehrenamtliche Führung und fehlende kaufmännische Leitung
Ein zentraler Hintergrundfaktor in Deutschland ist die Clubstruktur. Ein Großteil der traditionellen Golfclubs ist als eingetragener Verein (e.V.) organisiert, oft mit einem ehrenamtlichen Vorstand an der Spitze. Der Präsident oder die Präsidentin agiert nominell als Clubmanager, ohne hauptberufliche Anstellung. Dieses Modell hat zwar den Vorteil der Mitgliederdemokratie, bringt aber Herausforderungen in der operativen Führung mit sich.
In Modellclubs, die keine hauptamtliche Geschäftsführung haben (häufig aus Kostengründen oder historisch gewachsen), liegt die operative Last auf Schultern der wenigen angestellten Kräfte: typischerweise Sekretariat/Verwaltung und dem Golfprofessional. Entscheidungen müssen jedoch formell vom Vorstand getroffen werden, was zu Verzögerungen und Reibungen führen kann. Die Fachpresse beschreibt dieses Spannungsfeld so: Clubmanager beklagen Eingriffe des Vorstands ins Tagesgeschäft und zu geringe eigene Befugnisse, während Vorstände umgekehrt oft das Gefühl haben, zu wenig eingebunden zu sein (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Dieser Zielkonflikt zwischen ehrenamtlicher Führung und angestelltem Operativpersonal existiert ähnlich in vielen Golfvereinen.
Zwei grundsätzliche Modelle stehen sich gegenüber (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management):
- Modell A: Professionelles Clubmanagement: Der Club stellt einen hauptamtlichen Clubmanager ein und der Vorstand übernimmt primär eine aufsichtsrätliche, strategische Rolle. Tagesgeschäft und operative Entscheidungen liegen beim angestellten Manager (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Dieses Modell entspricht einer unternehmerischen Führung und wird von Experten als effizientestes angesehen – erfordert jedoch, dass der Vorstand loslassen kann und dem Management vertraut (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management) (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management).
- Modell B: Ehrenamtliches Management: Der Vorstand führt den Club selbst operativ, unterstützt durch wenige Angestellte (z.B. Sekretariat). Es gibt keine klare Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Damit dieses Modell funktioniert, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein: viel Zeit beim Vorstand (für ad-hoc Entscheidungen im Alltag), entsprechende Fachkompetenz der Ehrenamtler in ihren Bereichen und Konsequenz in der Aufgabenerledigung (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management) (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Fehlt es an Zeit oder Erreichbarkeit (z.B. Vorstandsmitglieder beruflich auf Reisen), entstehen schnell Frustration bei Mitarbeitern und Mitgliedern wegen ausbleibender Entscheidungen (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management).
In der Praxis wählt eine Mehrheit der traditionellen Clubs eher eine Mischform, tendierend zu Modell B – sprich: kein vollwertiger Manager, aber auch kein vollständig selbstführender Vorstand, sondern irgendetwas dazwischen. Hier kommt der PGA-Professional ins Spiel: Oft füllt er faktisch die Lücke, ohne dass es formal so definiert ist. Er ist derjenige vor Ort, der ständig ansprechbar ist und daher zwangsläufig Führungsaufgaben übernimmt, jedoch ohne entsprechendes Mandat oder Vertragsstatus. Diese strukturelle Gegebenheit erklärt teilweise, warum der Einfluss der Pros auf offizielle Beschlüsse begrenzt bleibt: Sie sind nicht per se Teil des Vorstands oder Managements, sondern stehen in der Hierarchie meist eine Stufe tiefer (als Dienstleister oder Abteilungsleiter Sport).
Zudem fehlt es vielen Clubs an kaufmännischer Leitung und moderner Personalführung. Es gibt keine tariflichen Regelungen; Gehaltsverhandlungen erfolgen individuell, oft mit dem Verein als stärkeren Verhandlungspartner (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Human Resource Management im Golfsport) (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Human Resource Management im Golfsport). Die Karriereperspektiven innerhalb eines Clubs sind flach – ein Pro kann selten intern „aufsteigen“, da es nur wenige Hierarchieebenen gibt (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Ambitionierte Fachleute wechseln dann entweder den Club (zu einem größeren mit mehr Möglichkeiten) oder verlassen die Branche (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Dieser Fachkräfteschwund droht auch bei PGA-Professionals, wenn sie keine Entwicklungschancen sehen.
Vergleichbare Trends in den USA und Übertragbarkeit
Ein Blick in die USA – wo Golfclubs oft unternehmerischer geführt werden – zeigt parallele Problemstellungen, aber auch Unterschiede. Dort hat sich in den letzten Jahrzehnten eine Professionalisierung des Clubmanagements vollzogen: Viele Clubs stellen hochqualifizierte General Manager (teils mit MBA-Abschluss) ein, die wie CEOs agieren (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). Diese Entwicklung hat die Gehaltsstrukturen auseinanderdriften lassen. Laut aktuellen Berichten verdienen General Manager in US-Privatclubs heute teils 175.000 bis 350.000 $ pro Jahr, während PGA-Head-Professionals meist nur im Bereich 70.000–110.000 $ liegen (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). Hinzu kommt, dass Club-Pros dort traditionelle Zusatzverdienste verloren haben – etwa die Beteiligung am Pro-Shop-Umsatz oder Cart-Gebühren, die früher einen großen Anteil des Einkommens ausmachten (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). Die Folge: Mehr Verantwortung, aber weniger finanzieller Anreiz für die Pros, ähnlich wie in Deutschland.
Allerdings unterscheiden sich die Ausgangsstrukturen: In den USA sind sowohl GM als auch Head-Pro in aller Regel hauptamtliche Angestellte des Clubs. Der Einfluss der Head-Pros wurde dort durch die Etablierung des GM-als-CEO-Modells geschmälert (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). In Deutschland hingegen ist das Problem oft, dass gar keine professionelle Managementstelle existiert und damit Aufgaben diffus verteilt sind – was den Pros zwar implizit viel Macht über das Tagesgeschäft gibt, ihnen aber explizit kein formelles Mitspracherecht in der strategischen Clubführung einräumt.
Trotz dieser Unterschiede sind einige Trends übertragbar: So zeigt das US-Beispiel, wie wichtig es ist, Einnahmequellen und Verantwortung der Pros in Einklang zu bringen, damit der Beruf attraktiv bleibt. Auch in Deutschland sieht man bereits erste Anzeichen von Einkommenslücken zwischen modernen Clubmanagern (wo sie eingestellt werden) und den Golflehrern. Die Lehre aus den USA könnte sein, in Deutschland frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen, bevor sich die Kluft verfestigt.
Ein weiterer Aspekt ist die Arbeitsbelastung: Sowohl hier wie dort stehen PGA-Professionals oft unter erheblichem Druck, lange Arbeitszeiten (insbesondere in der Saison, Wochenenden/Feiertage) und vielfältige Aufgaben zu bewältigen. In den USA wird vermehrt über Work-Life-Balance und die Gefahr des Burn-outs bei Club-Pros diskutiert (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap) – Themen, die auch in Deutschland Relevanz haben.
Zusammenfassend bietet der Vergleich vor allem eine Mahnung: Ohne Anpassungen laufen auch deutsche Golfclubs Gefahr, dass hochqualifizierte Golfprofessionals abwandern oder der Beruf an Attraktivität verliert, wenn Verantwortung und Reward in Schieflage geraten. Die folgende Strategie greift daher sowohl branchenspezifische deutsche Besonderheiten als auch Lessons Learned aus den USA auf.
Rolle der PGA of Germany und weiterer Institutionen
Die PGA of Germany als Berufsverband der Golfprofessionals spielt eine Schlüsselrolle bei Ausbildung, Zertifizierung und Interessenvertretung ihrer Mitglieder. Sie stellt sicher, dass angehende Pros eine hochwertige Ausbildung durchlaufen und fördert ihre fachliche Weiterentwicklung (z.B. über Fortbildungen, Seminare, Zertifikate). In Bezug auf die Problematik der Vergütung und Einflussmöglichkeiten ist die PGA prädestiniert, Vermittler zwischen Pros und Clubs zu sein. Bisher agiert sie vor allem auf qualitativer Ebene – sie wirbt mit „hochattraktivem Arbeitsmarkt, besten Job-Aussichten und guten Verdienstmöglichkeiten“ (Golflehrer: Beruf mit besten Aussichten – PGA), um Nachwuchs anzuziehen, und betont die vielfältigen Karrierewege. Konkrete Gehaltsrichtlinien oder tarifähnliche Absprachen gibt es aber nicht; der Markt regelt das weitgehend selbst.
Gleichzeitig ist die PGA of Germany eingebunden in Initiativen wie „Traumjob Golfplatz“, die gemeinsam mit dem DGV (Deutscher Golf Verband), GMVD und dem Greenkeeper-Verband gestartet wurden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken (Das Karriereportal „Traumjob Golfplatz“ ). Diese Initiative zielt darauf ab, Berufsprofile im Golf transparenter und attraktiver zu machen. Im Klartext erkennt man: Stellen als Clubmanager oder Golflehrer können derzeit oft nicht adäquat besetzt werden, weil Fachkräfte fehlen (Das Karriereportal „Traumjob Golfplatz“ ). Das hat die Branche alarmiert. Eine verbesserte Attraktivität des Berufs Golfprofessional – durch bessere Bezahlung, klarere Karrierewege und mehr Anerkennung – liegt also im Interesse aller Verbände, nicht nur der PGA, sondern auch des DGV (der stabile Clubs mit gutem Sportangebot möchte) und des GMVD (der professionelle Clubführung fördert).
Weitere Institutionen wie die Clubmanagement Verband Deutschland (GMVD) setzen sich für die Professionalisierung der Clubführung ein und bieten Zertifizierungen für Manager an (kürzlich wurde etwa eine Kooperation mit der europäischen Clubmanager-Vereinigung CMAE geschlossen (GMVD und CMAE schließen Kooperation ab)). Auch wenn GMVD-Mitglieder primär Geschäftsführer und Sekretäre sind, profitieren PGA-Professionals indirekt von klareren Führungsstrukturen, die der GMVD propagiert.
Zudem sind viele Golfpros selbst Mitglied in Netzwerken und nehmen an Konferenzen teil, wo Best Practices diskutiert werden. Letztlich können alle Beteiligten – PGA, DGV, GMVD, Clubs – nur in Abstimmung die Situation verbessern. Die PGA könnte beispielsweise Empfehlungen zu Honorar und Arbeitsumfang aussprechen oder eine Plattform zum Austausch zwischen Clubvorständen und Professionals bieten. Der DGV könnte in seinen Beratungen an Vereine verstärkt auf die Notwendigkeit einer angemessenen Einbindung von Professionals hinweisen. Und nicht zuletzt haben auch Mitglieder und Ehrenamtliche eine Verantwortung: Wertschätzung beginnt im täglichen Umgang – ein Klima, in dem der Professional als gleichwertiger Bestandteil des Führungsteams gesehen wird, muss von oben (Präsidium) und von der Basis (Mitgliedschaft) gefördert werden.
Strategie und Handlungsempfehlungen
Vor dem skizzierten Hintergrund bedarf es einer ganzheitlichen Strategie, die an drei Hebeln ansetzt: (1) Vergütungsmodelle optimieren, (2) Anerkennung und Einfluss der PGA-Professionals erhöhen und (3) Organisationsstrukturen sowie Kommunikation im Club verbessern. Im Folgenden werden für jeden Bereich konkrete, umsetzbare Maßnahmen vorgeschlagen, die speziell auf die Verhältnisse deutscher Golfclubs zugeschnitten sind.
1. Verbesserung der Vergütungsmodelle
Ein Kernanliegen ist die faire und leistungsgerechte Bezahlung der Golfprofessionals. Hier einige Maßnahmen, die Clubs ergreifen können:
- Gehaltsbenchmarking und Transparenz: Clubs sollten regelmäßig Marktvergleiche anstellen, was PGA-Professionals in ähnlicher Position verdienen. Branchenberichte und Umfragen (z.B. von GMVD oder PGA) können Anhaltspunkte liefern. Ein Ziel könnte sein, das Gehalt eines fully qualified Professionals in Richtung des branchenweiten Durchschnitts (z.B. ≥50.000 €) zu entwickeln statt am untersten Ende zu verharren (Golflehrer/in Gehälter in Deutschland 2025 – StepStone ) (So viel verdienen Fach- und Führungskräfte in der Golfbranche). Intern sollte das Thema offen angesprochen werden – Transparenz schafft Verständnis bei Vorständen und Professionals gleichermaßen.
- Hybride Vergütungsmodelle: Statt rein auf Honorarumsätze zu setzen, empfehlen sich Mischmodelle aus Grundgehalt und leistungsbezogenen Komponenten. Beispielsweise könnte ein Pro einen festen Basislohn erhalten, der wichtige Kernaufgaben (Training, Turnierleitung, Mitgliederservice) abdeckt, plus variable Anteile für bestimmte Erfolge: Provision auf Unterrichtseinnahmen über einem Schwellenwert, Gewinnbeteiligung am Pro-Shop-Umsatz, Bonus für gewonnene Neumitglieder oder erfolgreiche Mannschaftsergebnisse. So wird Mehrleistung honoriert, ohne dass das Grundgehalt unsicher bleibt.
- Vergütung zusätzlicher Aufgaben: Alle Aufgaben jenseits des Unterrichts (z.B. Organisation des Spielbetriebs, Verwaltungstätigkeiten) sollten klar definiert und vergütet werden. Ein Club kann bspw. jährliche Pauschalen zahlen für die Rolle des „Sportdirektors“ oder „Jugendkoordinators“, falls der Pro diese Rollen übernimmt. Alternativ kann man auf Stundenbasis abrechnen: z.B. X Euro pro Turniertag als Aufwandentschädigung. Wichtig ist, dass diese Arbeiten nicht als kostenlose Gefälligkeiten angesehen werden – schließlich würde ein extern engagierter Turnierorganisator auch entlohnt.
- Weiterbildung und Qualifizierung belohnen: Viele Professionals erweitern stetig ihre Qualifikationen (Diplom-Trainer, C/B/A-Trainer-Lizenzen, Fitnesstrainer, Clubmanager-Lehrgänge etc.). Clubs sollten solche Fortbildungen finanziell unterstützen (z.B. Kursgebühren übernehmen) und bei Abschluss mit Gehaltserhöhungen oder Beförderungen honorieren. Dies schafft einen Anreiz, sich breiter aufzustellen, wovon wiederum der Club profitiert (breiteres Kompetenzprofil im Haus). Laut GMVD-Umfrage zählen Kostenübernahmen für Fortbildung zu den häufigsten Zusatzleistungen in der Branche (So viel verdienen Fach- und Führungskräfte in der Golfbranche) – dies sollte auch für PGA-Pros gelten.
- Nachhaltige Vertragsmodelle: Wo möglich, sollten Clubs prüfen, Golfpros in Festanstellung zu übernehmen statt ausschließlich auf Selbständigkeit zu pochen. Eine Festanstellung mit sozialer Absicherung, Urlaubsanspruch und planbarem Gehalt macht die Position attraktiver und bindet gute Fachleute länger an den Club. Ist eine Anstellung (noch) nicht praktikabel, könnten Alternativen geschaffen werden: z.B. mehrjährige Dienstleistungsverträge mit Einkommensgarantie (ein fixes Mindesteinkommen pro Jahr, aufgestockt durch variable Anteile). So erhält der Pro Planungssicherheit. Gleichzeitig kann in solchen Verträgen auch die Erwartung an seine vielfältigen Leistungen festgeschrieben werden – was wiederum Klarheit für beide Seiten schafft.
- Zusammenarbeit benachbarter Clubs: Insbesondere für kleinere Anlagen mit begrenztem Budget lohnt der Blick über den Tellerrand: Kooperationen zwischen Clubs bei der Anstellung von Professionals. Beispielsweise könnten zwei benachbarte 9-Loch-Clubs sich einen Head-Pro „teilen“ und gemeinsam ein attraktives Vollzeit-Paket schnüren, anstatt zwei halbe Stellen, die jeweils dürftig bezahlt sind. Solche Modelle erfordern Absprache, sichern aber dem Pro ein höheres Gesamteinkommen und beiden Clubs qualifizierten Service.
Durch diese und ähnliche Schritte kann die Vergütung näher an die tatsächliche Wertschöpfung durch den Professional heranrücken. Sie senden auch ein Signal der Wertschätzung. Wichtig ist, dass Vorstände den Professional nicht als Kostenstelle, sondern als Investition in Mitgliederzufriedenheit und Clubqualität betrachten – was er erwiesenermaßen ist.
2. Mehr Anerkennung und Einfluss für PGA-Professionals
Finanzielle Anreize allein genügen nicht; ebenso entscheidend sind ideelle Wertschätzung und echte Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Professionals im Club. Folgende Maßnahmen zur Stärkung von Anerkennung und Einfluss sind empfehlenswert:
- Einbindung in Gremien und Entscheidungen: Ein PGA-Professional sollte von Amts wegen in relevante Clubgremien einbezogen werden. Etwa könnte man den Head-Pro als beratendes Mitglied im Vorstand aufnehmen oder zumindest zu Vorstandssitzungen einladen, wenn sportliche oder operative Themen besprochen werden. Seine Expertise kann die Entscheidungen bereichern – und er fühlt sich ernstgenommen. Alternativ kann ein Sportausschuss installiert werden, dem der Pro angehört oder vorsitzt, mit direkter Berichtslinie an den Vorstand.
- Klare Positionsbezeichnung und Stellenbeschreibung: Statt den Professional im Organigramm unten einzuordnen, kann man ihm einen angemessenen Titel geben, der seinen tatsächlichen Beitrag widerspiegelt – z.B. „Leiter Golfbetrieb“ oder „Director of Golf“. Diese Funktionsbezeichnung sollte mit einer schriftlichen Stellenbeschreibung untermauert werden, die Verantwortungsbereiche und Entscheidungsbefugnisse festhält. So weiß jeder im Club, dass der Pro autorisiert ist, bestimmte Entscheidungen zu treffen (z.B. Trainingsbudgets zu verwalten, Turnierabläufe zu bestimmen etc.). Das erhöht automatisch sein Standing und entlastet den Vorstand von Mikro-Management.
- Regelmäßige Kommunikation und Feedback: Etablieren Sie feste Austauschformate zwischen Professional und Vorstand/Präsident. Zum Beispiel ein wöchentliches Jour fixe oder Reporting, in dem der Pro über die Lage im Club (Mitgliederstimmung, sportliche Belange, Probleme) berichtet und Anliegen vorbringen kann. Gleichzeitig sollte der Vorstand Feedback und Vereinsziele kommunizieren. Dieser Dialog auf Augenhöhe stellt sicher, dass der Professional stets informiert ist und mitreden kann, bevor Entscheidungen getroffen werden, die seinen Arbeitsbereich betreffen. Es verhindert zudem das Gefühl des Pros, von wichtigen Entwicklungen ausgeschlossen zu sein.
- Anerkennungskultur im Club fördern: Kleine Gesten können viel bewirken. Der Club sollte Erfolge und Einsatz des Professionals sichtbar würdigen. Beispielsweise kann man in Club-Newslettern oder Versammlungen erwähnen, was dank des Pros erreicht wurde (etwa erfolgreiche Jugendcamps, Mitgliederzuwächse durch Schnupperkurse, Turnier-Highlights). Denkbar ist auch eine jährliche Auszeichnung (z.B. “Mitarbeiter des Jahres” o.Ä.), bei der oft der Pro gute Chancen hätte, oder eine besondere Ehrung zu Dienstjubiläen. Wichtig ist, dass die Mitglieder und das Ehrenamt erkennen: Dieser Professional ist ein Eckpfeiler unseres Clubs. Eine Kultur der Wertschätzung motiviert den Pro und stärkt seinen Einfluss informell, da sein Wort mehr Gewicht bekommt, wenn alle hinter ihm stehen.
- Mentoring und persönliche Weiterentwicklung: Bieten Sie dem Professional die Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln – nicht nur fachlich, sondern auch in Richtung Management. Zum Beispiel könnte der Club einen erfahrenen Manager (evtl. aus einem benachbarten Club oder aus dem GMVD-Netzwerk) als Mentor für den Pro gewinnen, um ihm bei betriebswirtschaftlichen Fragen zu helfen. Auch ein temporärer Austausch (Praktikum) in der Clubverwaltung oder das Absolvieren eines Clubmanager-Zertifikats (wie es der GMVD anbietet) könnten gefördert werden. Ein Professional, der spürt, dass er eine Karriereperspektive hat – vielleicht vom „Head-Pro“ hin zum „Golfmanager“ – wird sich stärker mit dem Club identifizieren und Verantwortung übernehmen wollen. Gleichzeitig wächst sein Einfluss organisch mit seinen Kenntnissen.
- Unterstützung durch Team und Hilfskräfte: Um zu verhindern, dass der Pro sich verzettelt und ausgebrannt fühlt, sollten Clubs ihn von Routineaufgaben entlasten, damit er sich auf hochwertige Tätigkeiten konzentrieren kann. Das heißt z.B. Assistenztrainer für Einsteigerkurse beschäftigen, Aushilfen für Shop und Driving Range Service einstellen, administrative Aufgaben (Planung, Abrechnung) soweit möglich ans Sekretariat delegieren. Wenn der Pro „zu viele Hüte trägt“ (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap), leidet nicht nur die Qualität, sondern auch seine Möglichkeit, strategisch mitzuwirken. Mit einem kleinen Team um sich kann er sich freispielen für Führungsaufgaben und wichtige Projekte (z.B. Entwicklung neuer Kursangebote, Mitgliederbindungskonzepte), was wiederum seine Wirksamkeit im Club erhöht. Hier kann auch die PGA of Germany Hilfestellung geben, indem sie z.B. Poollösungen für Assistenz-Pros vermittelt (viele Auszubildende suchen Praxisstellen).
Kurzum: Anerkennung zeigen und Verantwortungsbereiche erweitern gehen Hand in Hand. Ein Professional, der spürt, dass er respektiert wird und gestalten darf, wird sich mit voller Energie einbringen – zum Wohle des Clubs. Die Kunst für den Vorstand besteht darin, Vertrauen zu geben und den Pro wirklich als Partner zu betrachten, nicht bloß als Erfüllungsgehilfen. Wenn das gelingt, wächst der Einfluss des Professionals auf natürliche Weise und formale Titel werden fast zur Nebensache, weil faktisch eine Führung auf Augenhöhe gelebt wird.
3. Optimierung der Organisationsstruktur und Kommunikation
Langfristig lässt sich die Diskrepanz nur beheben, wenn auch die organisatorischen Rahmenbedingungen in den Clubs weiterentwickelt werden. Es gilt, die Struktur so anzupassen, dass Professionalität in der Führung einkehrt, ohne die Vorteile der ehrenamtlichen Kultur aufzugeben. Hierfür folgende Handlungsempfehlungen:
- Professionelles Clubmanagement etablieren (Modell A): Wo immer möglich, sollte ein Club prüfen, einen hauptamtlichen Clubmanager/Geschäftsführer einzustellen (oder einen bestehenden Mitarbeiter – etwa den Head-Pro – in diese Rolle hineinwachsen zu lassen). Das entlastet den ehrenamtlichen Vorstand und sorgt für klare Zuständigkeiten. Der Vorstand kann sich dann strategischen Fragen widmen und die Aufsicht führen (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Wichtig ist, diese Person mit den nötigen Befugnissen auszustatten (Budgetverantwortung, Personalführung etc.), damit das Tagesgeschäft effizient läuft (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Ein Professional könnte diese Position unter Umständen ausfüllen, sofern er die kaufmännischen Kenntnisse hat oder entsprechend geschult wird. Einige Clubs haben bereits erfolgreich „Director of Golf“ Positionen geschaffen, die sowohl sportliche als auch administrative Leitung vereinen. Dieses Modell könnte Schule machen, gerade wenn kein anderer geeigneter Manager verfügbar ist.
- Alternativen im Ehrenamtsmodell (Modell B) verbessern: Nicht jeder Club kann sofort einen Manager finanzieren. Im ehrenamtlich geführten Club sollte dann zumindest eine sinnvolle Aufgabenverteilung im Vorstand erfolgen (z.B. Ressorts: Sport, Platz, Finanzen, Mitglieder) und jedem Ressort ein Ansprechpartner im operativen Team zugeordnet werden. Insbesondere das Ressort „Sportbetrieb“ sollte eng mit dem Professional verzahnt sein. Wenn ein Vorstandsmitglied Sport vorhanden ist, kann es als Sparringspartner des Pros fungieren – regelmäßige Treffen, gemeinsames Planen der Saison etc. existieren bereits in manchen Vereinen als Sportausschuss. Wichtig: Die Erreichbarkeit der ehrenamtlichen Entscheider muss gewährleistet sein. Wenn der Vorstand schon operativ mitmischt, dann bitte mit Verlässlichkeit und schneller Reaktionszeit, damit der Pro nicht im Regen steht, wenn er eine Zustimmung benötigt. Hier kann z.B. eine Eskalationsregelung helfen: Ist das zuständige Vorstandsmitglied abwesend und eine Entscheidung dringend, darf der Professional in Absprache mit einem anderen Präsidiumsmitglied eigenständig handeln. Solche klaren Regeln verhindern Stillstand und Frust (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management) (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management).
- Geschäftsordnung und Delegationsregeln: Eine schriftliche Geschäftsordnung kann festhalten, welche Entscheidungen der Professional (bzw. Clubmanager) eigenständig treffen darf und welche dem Vorstand vorbehalten sind (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Ehrenamt versus bezahltes Management). Zum Beispiel: Ausgaben bis zu einem bestimmten Betrag, Kursangebote, Turnierdurchführungen nach Standardvorgaben – all das könnte in den Verantwortungsbereich des Pros fallen, ohne jedes Mal Beschlüsse abwarten zu müssen. Solch ein Regelwerk schafft Sicherheit für beide Seiten: Der Pro bewegt sich in einem definierten Rahmen und der Vorstand weiß zugleich, dass er bei wichtigen Fragen weiterhin involviert ist. In vielen Clubs fehlt so etwas, wodurch Unsicherheit herrscht. Dieses Defizit lässt sich relativ leicht beheben.
- Verbesserte interne Kommunikation: Ein häufiges Problem in ehrenamtlich geprägten Strukturen ist der Informationsfluss. Daher sollten Clubs bewusst Kommunikationskanäle implementieren: z.B. ein wöchentliches internes Bulletin, in dem alle Abteilungen kurz berichten (Pro, Greenkeeper, Sekretariat) – so sind auch abwesende Vorstände auf dem Laufenden. Moderne Tools (WhatsApp-Gruppen, Cloud-Dokumente) können helfen, Informationen schnell zu teilen. Wenn der Professional z.B. feststellt, dass an Wochenenden Engpässe im Sekretariat auftreten, sollte das rasch an den Vorstand kommuniziert werden können und Lösungen (Aushilfen, geänderte Öffnungszeiten) gemeinsam beschlossen werden. Offene, regelmäßige Kommunikation beugt Missverständnissen vor und stärkt das Teamgefühl im Club.
- Netzwerke und Austausch nutzen: Clubs sollten nicht isoliert agieren, sondern von einander lernen. Über Verbandsangebote wie Workshops oder Regionaltreffen (z.B. vom DGV oder PGA Sektionen) kann man Erfolgsbeispiele kennenlernen. Ein Club, der bereits einen Professional im Vorstand integriert hat oder innovative Vergütungsmodelle nutzt, kann sein Wissen teilen. Auch Best-Practice-Leitfäden der PGA of Germany oder DGV könnten entwickelt werden, um Clubs konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben. Die PGA könnte z.B. einen Mustervertrag für die Zusammenarbeit Club–Professional veröffentlichen, der viele der genannten Punkte standardisiert (ähnlich wie es in anderen Branchen Verbandsempfehlungen gibt).
- Mitglieder sensibilisieren: Letztlich sollten auch die Clubmitglieder verstehen, welche Rolle der Professional spielt. Ein informierter Mitglied wird z.B. eher bereit sein, angemessene Trainerhonorare zu akzeptieren oder eine Beitragserhöhung mitzutragen, wenn er weiß, dass damit der Verbleib eines hervorragenden Pros gesichert wird. Daher empfiehlt es sich, im Rahmen von Mitgliederversammlungen oder Clubzeitschriften offen über Personalstrategie zu sprechen: Warum ist es wichtig, gute Leute gut zu bezahlen? Was leistet der Pro alles für uns? Dieser Bewusstseinswandel in der Breite kann Druck von den Entscheidungsträgern nehmen, da die Maßnahmen zur Besserstellung der Pros auf breitere Zustimmung treffen.
Zusammengefasst zielen diese organisatorischen Maßnahmen darauf ab, Professionalität und Effizienz im Clubmanagement zu steigern. Ein Club, der klare Strukturen hat, wird auch fairere und transparentere Beziehungen zu seinen Professionals pflegen können. Insbesondere der Schritt hin zu hauptamtlicher Führung (sei es durch einen Manager oder durch Aufwertung des Pros) dürfte in vielen Fällen der nachhaltigste Lösungsansatz sein, um dem Spannungsfeld von Verantwortung und Vergütung zu entkommen. Die Realität zeigt: Wo ein Club wie ein Unternehmen geführt wird, steigen oft die Zufriedenheit und auch die wirtschaftliche Basis, wovon wiederum alle – inklusive der Professionals – profitieren (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). Es muss jedoch immer auf die jeweilige Clubgröße und Kultur angepasst werden; es gibt keine Einheitslösung, aber die genannten Prinzipien sind breit anwendbar.
Fazit
Die Diskrepanz zwischen Bedeutung und Vergütung von PGA-Professionals in deutschen Golfclubs ist ein komplexes Problem, das nur mit einem Bündel an Maßnahmen angegangen werden kann. Deutsche Golfclubs sind gefordert, ihre eingespielten Muster zu überdenken: Weg von der Selbstverständlichkeit, dass ein Professional schon alles irgendwie regelt, hin zu einer bewussten Wertschätzungskultur und professionellen Vereinsführung. Das vorgestellte Strategiepaket – von verbesserten Gehaltsmodellen über erweiterte Einflussrechte bis zur Reform der Organisationsstruktur – bietet einen Leitfaden, um diese Veränderung praktisch umzusetzen.
Kurzfristig mögen einzelne Schritte wie Gehaltserhöhungen oder die Einladung des Pros in den Vorstand ungewohnt erscheinen; langfristig sichern sie jedoch die Qualität und Zukunftsfähigkeit des Clubs. Denn nur mit motivierten, fair behandelten und engagierten Professionals an ihrer Seite können Golfvereine ihren Mitgliedern ein erstklassiges Angebot bieten und im Wettbewerb um Mitglieder und Fachkräfte bestehen.
Die PGA of Germany, der DGV und der GMVD können diesen Wandel begleiten, indem sie Aufklärung betreiben und Best Practices teilen. Letztlich liegt es aber an jedem Club selbst, die Weichen zu stellen. Die zentrale Botschaft lautet: Der PGA-Professional ist mehr als ein Golflehrer – er ist ein essenzieller Wertträger des Clubs. Indem man ihm angemessene Vergütung, echte Mitsprache und ein professionelles Umfeld bietet, investiert man direkt in den Erfolg und die Attraktivität des eigenen Clubs. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zeigen einen Weg auf, wie aus dem heutigen Spannungsfeld ein künftiges Erfolgsmodell für beide Seiten werden kann – im Sinne eines modernen, fairen Miteinanders im deutschen Golfsport.

Hat Ihnen der Artikel „Strategie zur Stärkung von PGA-Professionals in deutschen Golfclubs“ gefallen?
Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren, Diskutieren Sie mit uns auf LinkedIn oder schreiben Sie uns direkt! Gemeinsam gestalten wir die digitale Zukunft Ihres Golfclubs! Jetzt unverbindlich anfragen.
Thomas Wulff
Vielen Dank!
Quellen:
Aktuelle Erkenntnisse und Daten wurden u.a. folgendermaßen entnommen: Gehaltsdaten für Golflehrer (StepStone) (Golflehrer/in Gehälter in Deutschland 2025 – StepStone ), Branchenstudien zum Personal in Golfanlagen (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Human Resource Management im Golfsport) (GMGK – Köllen Druck und Verlag GmbH: Human Resource Management im Golfsport), Initiativen und Verbandsaussagen (PGA of Germany, DGV) (Das Karriereportal „Traumjob Golfplatz“ ) (Golflehrer: Beruf mit besten Aussichten – PGA) sowie internationale Vergleiche (Artikel zum US-Clubmanagement) (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap) (PGA Pro Versus Club Manager the Growing Income Gap). Diese und weitere im Text ausgewiesene Quellen untermauern die Analyse und empfohlenen Schritte.